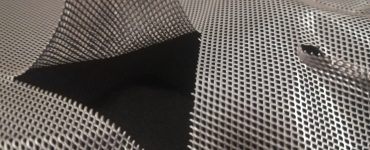Die Regierung hatte nur einen kleinen rechtlichen Gestaltungsspielraum, diesen hat sie nun allerdings voll ausgeschöpft: für Mädchen in öffentlichen Volksschulen gilt bald ein Kopftuchverbot.
Am Mittwoch, dem 15. Mai 2019, wurde im Nationalrat die Änderung des Schulunterrichtsgesetzes beschlossen. Durch diese Änderung ist es Mädchen in Zukunft verboten, bis zu jenem Schuljahr, in dem sie das zehnte Lebensjahr vollenden, in öffentlichen Schulen ein Kopftuch zu tragen. Dazu wurde ein neuer einfachgesetzlicher Paragraf in das Schulunterrichtsgesetz eingefügt (§ 42a SchUG). Ursprünglich war eine Regelung im Verfassungsrang geplant, doch es fand sich keine nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Opposition stellte die Notwendigkeit und Effektivität einer solchen Regelung in Frage. Für das Verbot stimmten die Regierungsparteien und zwei Abgeordnete der Liste JETZT (Peter Pilz und Daniela Holzinger-Vogtenhuber).
Aufgrund des Beschlusses auf einfacher Gesetzesebene steht das Kopftuchverbot in öffentlichen Volkschulen nicht auf Augenhöhe mit der Glaubens- und Religionsfreiheit, welche als Grundrecht nach Artikel 14 des Staatsgrundgesetzes und Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) in Verfassungsrang steht. Im Fall einer Grundrechts- bzw. Gesetzesbeschwerde aufgrund eines Individualantrages vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird dieser daher zu prüfen haben, ob der neue Paragraf das Grundrecht auf freie Religionsausübung unverhältnismäßig einschränkt (siehe auch reflektive-Beitrag). Sollte er zu diesem Ergebnis kommen, wäre der Paragraph als verfassungswidrig aufzuheben.
Ebenfalls mutig ist hier die Begründung der Koalitionsparteien im Unterrichtsausschusses (Ausschussbericht), dass überhaupt keine Verfassungsbestimmung notwendig sei um dieses Verbot zu realisieren, da es bereits seit kurzem auf Länderebene aufgrund einer sogenannten 15a-Vereinbarung (siehe reflektive-Beitrag) gleichlautende Bestimmungen gibt, welche der Verfassungsgerichtshof bis jetzt noch nicht gekippt hat. Da es allerdings noch keine Entscheidung bezüglich der Verfassungskonformität dieser Bestimmungen gibt, bleibt abzuwarten, ob der Verfassungsgerichtshof diese Ansicht teilt – denn nur auf dessen Rechtsprechung kommt es schlussendlich an.
Gleiches ungleich behandelt
Kritisch hervorzuheben ist auch, dass sich die Regelung nur auf muslimische Schülerinnen („das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist“) unter zehn Jahren bezieht. Die jüdische Kippa und die Patka der Sikhs – beide von Buben beziehungsweise Männern getragen – sind hingegen ausdrücklich von dem Verbot ausgenommen. Umso erstaunlicher ist es dann, wenn man in dem Bericht des Unterrichtsausschusses nachliest, dass auch die Gleichstellung von Mann und Frau hierdurch verdeutlicht werden soll. Aber wie erklärt man diese Gleichstellung einem Kind, dass der gläubige Bub etwas darf, das gläubige Mädchen aber nicht?
Heikel wird es auch, wenn Religionen untereinander unterschiedlich behandelt werden. Der Gleichheitssatz der Verfassung verlangt es, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. Andere Staaten, wie z.B. Frankreich verbannten deshalb alle religiösen Symbole aus der Schule, ohne zwischen Religionen zu differenzieren. Die österreichische Regelung steht somit auf wackeligen Beinen.
Reine Symbolpolitik
Das Verbot umfasst nur Volksschülerinnen, somit unmündige Kinder, denen man noch keine religiöse Selbstbestimmung zutraut. Die Regierung hatte von vorne herein nur einen kleinen rechtlichen Gestaltungsspielraum, diesen hat sie nun allerdings voll ausgeschöpft; spätestens mit dem Erreichen der Mündigkeit im Alter von 14 Jahren muss man die Wünsche der Jugendlichen ernst nehmen, da man ihnen ab diesem Alter die freie Wahl einer Religion und deren Ausübung bereits zutrauen kann und nicht pauschal von einer Beeinflussung durch die Eltern sprechen kann. Der tatsächliche Anwendungsbereich dieses Gesetz wird vermutlich sehr klein bleiben, da Schülerinnen über zehn Jahren weiterhin ein Kopftuch in der Schule tragen können und dürfen. Die angeblichen integrationspolitischen Effekte, die die Regierungsparteien als Motivation für diese Gesetzesänderung äußerten, kommen bei ihren WählerInnen als Schlagzeilen zwar gut an, werden allerdings in der Realität wenig bewirken.
Zum Nachlesen: Parlamentskorrespondenz vom 15.05.2019